Lateinamerika-Gipfel mit umstrittenem Überraschungsgast
Nicht nur die Teilnahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro spaltete den CELAC-Gipfel, auch die Initiative des mexikanischen Präsidenten, die CELAC als Gegenwicht zur OAS neu zu positionieren, fand keine Zustimmung.
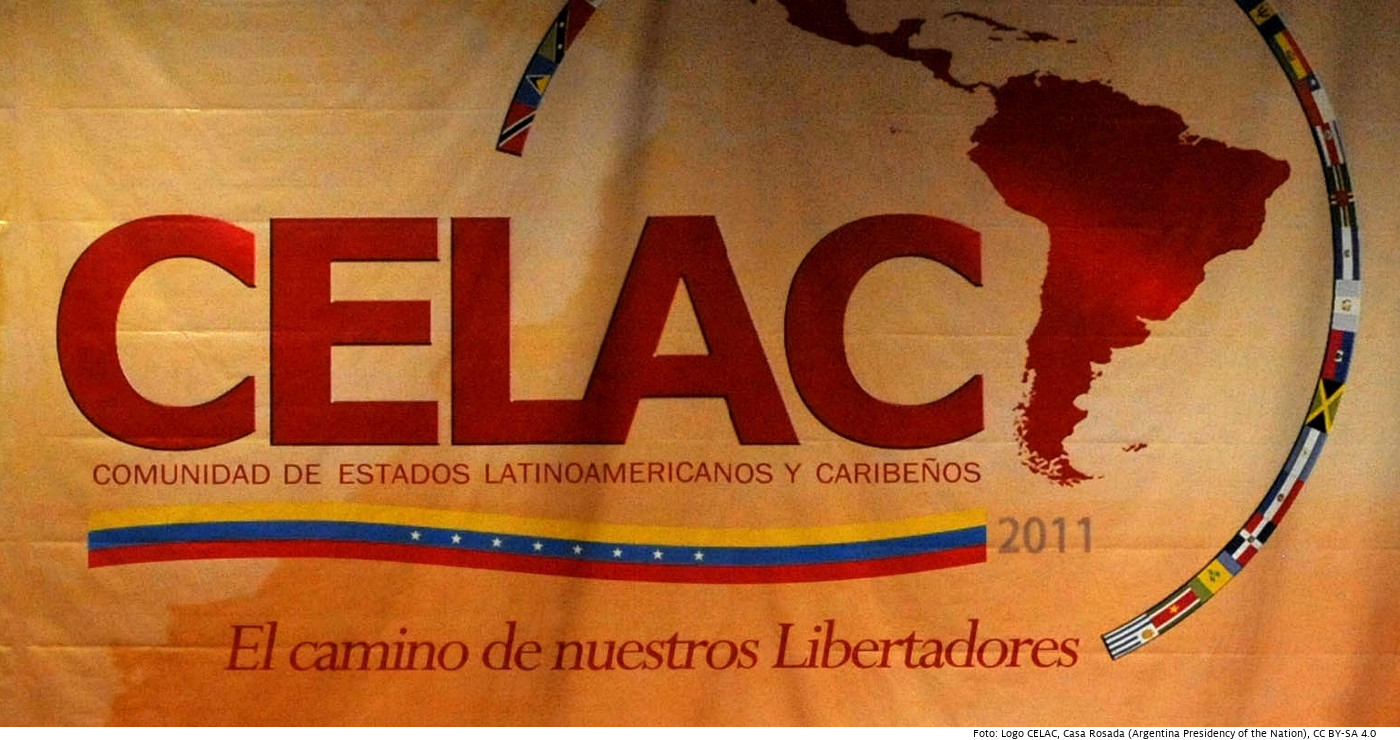
Logo CELAC 2011 (Symbolbild): Logo CELAC, Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY-SA 4.0
Die erste Überraschung auf dem Lateinamerika-Gipfel in Mexiko gab es schon vor dem Beginn. Als unerwarteter Teilnehmer flog in der Nacht zu Samstag der venezolanische Autokrat Nicolás Maduro ein, um am CELAC-Treffen teilzunehmen. Etwas unter dem Radar landete er als letzter der 15 Staats- und Regierungschefs in der mexikanischen Hauptstadt zum eintägigen Treffen, mit dem die „Gemeinschaft der Staaten Lateinamerikas und der Karibik“ (CELAC) zu neuem Leben erweckt und als Gegengewicht zur von den USA gegründeten und dominierten Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) positioniert werden sollte. So zumindest hatte es sich Mexikos linksnationalistischer Staatschef Andrés Manuel López Obrador vorgestellt. Am Ende aber scheiterte sein Projekt an den tiefen ideologischen Differenzen auf dem Subkontinent.
Teilnahme Maduros als Affront gegen die USA
Zuletzt hatte Maduro 2018 an einem internationalen Gipfel teilgenommen, als er anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen ebenfalls ohne Vorankündigung nach New York reiste. Im März 2020 lobte Washington eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für die Festnahme des venezolanischen Linksnationalisten unter dem Vorwurf aus, er fördere den Terrorismus und sei in den Drogenhandel verwickelt. Seither hatte Maduro Venezuela nicht mehr verlassen.
Dass er nun ausgerechnet im Nachbarland der Vereinigten Staaten an einem Spitzentreffen teilnimmt, ist eine besondere Spitze auch gegen Washington, die sich Gastgeber López Obrador gut überlegt hatte. Kubas Staatschef Miguel Díaz-Canel nahm ebenfalls an dem Treffen teil, dessen Vorschlag einer Einigung auf eine starke Allianz nach dem Vorbild der Europäischen Union unter dem Dach der CELAC keine Zustimmung fand. Auch die mexikanische Idee eins Wirtschafts- und Handelsabkommens mit den USA und Kanada fand keine große Zustimmung.
Ideologische Differenzen spalten den Kontinent
Schnell wurden die ideologischen Differenzen auf dem Subkontinent deutlich. Die rechts regierten Staaten Brasilien, Chile und Kolumbien waren erst gar nicht gekommen. Die linksliberale argentinische Regierung blieb wegen innenpolitischer Probleme und Streit zwischen Präsident Alberto Fernández und seiner Vize-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner auch zuhause. So blieb es an den beiden kleinen Ländern Paraguay und Uruguay hängen, die Gipfelcrasher zu geben. Beide Präsidenten, Mario Abdo Benítez und Luis Lacalle Pou, zeigten sich verstört von der Anwesenheit Maduros. „An diesem Forum teilzunehmen, bedeutet nicht, einverstanden zu sein damit, dass in bestimmten Ländern die Gewaltenteilung nicht respektiert wird, Oppositionelle mit staatlicher Repression unterdrückt und die Menschenrechte nicht respektiert werden“, sagte Uruguays konservativer Staatschef Lacalle Pou. Man könne nicht wegschauen, was in Venezuela, Kuba und Nicaragua passiere.
Einigkeit beim Thema "Fluchtursachen bekämpfen"
Die überraschende Teilnahme Maduros überschattete den Gipfel so sehr, dass die inhaltlichen Diskussionen fast in den Hintergrund traten. Insofern war seine Einladung ein Eigentor von López Obrador, der Mexiko als Stimme der Vermittlung und des Ausgleichs in Lateinamerika stärken will. Zurzeit ist das Land auch Gastgeber von Verhandlungen zwischen der venezolanischen Opposition und der Regierung. „Es ist Zeit, die Politik der Blockaden und wechselseitigen Misshandlungen durch Respekt zum Wohle Amerikas zu ersetzen“, forderte López Obrador zu Beginn des Gipfels. Bei seinen Gästen stieß das weitgehend auf taube Ohren.
Einig waren sich die Teilnehmer allerdings beim Thema Migration und Zentralamerika. Die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika CEPAL schlug Ende der Woche einen „Marshallplan für Mittelamerika“ vor, um die Fluchtursachen zu verringern. In den kommenden fünf Jahren sollen dafür 45 Milliarden Dollar aus privaten und öffentlichen Quellen aufgebracht werden. Das Geld soll dann über mehr als hundert Projekte die Infrastruktur, die Bildung, den Arbeitsmarkt und den Handel von allem in Guatemala, El Salvador und Honduras stärken. Aus diesen Ländern fliehen jährlich mehr als Hunderttausend Menschen aus Angst vor Gewalt und angesichts wirtschaftlicher Aussichtslosigkeit. Sie wollen vor allem in die Vereinigten Staaten.
